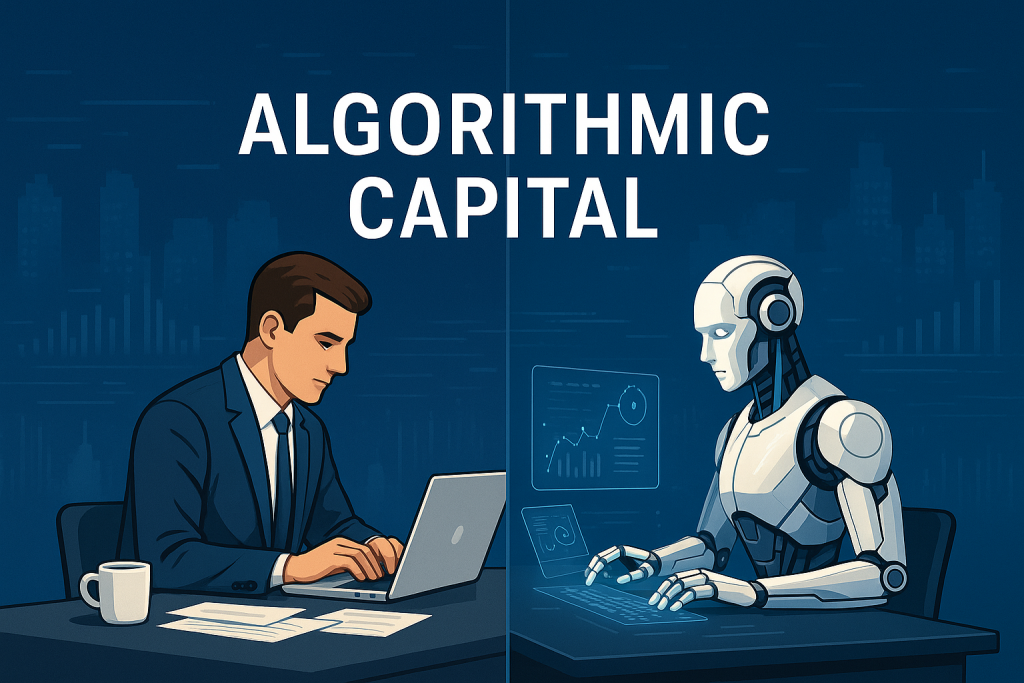
Sitze vor dem Laptop, der Earl Grey dampft, und ich merke, wie die Schlagzeilen über KI-Entlassungen inzwischen mehr Klicks ziehen als Katzenvideos. Früher hieß es immer: „Pass auf, sonst landet dein Job beim Callcenter in Manila oder bei der Softwarebude in Bangalore.“ Heute weiß ich: Mein Gegner trägt keinen Pass, sondern läuft auf GPUs.
Vom Human zum Algorithmic Capital
Die Manager haben das Spielbrett gewechselt. Einst wurden Tabellen gewälzt, ob man die Produktion nach Tschechien oder nach China verschiebt. Heute ist die Excel-Spalte „Personalkosten“ plötzlich mit einer neuen Zeile verknüpft: Algorithmic Capital. Das klingt fast poetisch, ist aber nichts anderes als Investitionen in KI-Systeme, die meinen Kollegen schneller, präziser – und manchmal gnadenloser – machen.
Der programmierende Inder war das Sinnbild der Globalisierung. Der Chatbot im Callcenter ist das Sinnbild der Algorithmisierung. Und ich frage mich: Wollen wir wirklich in einer Welt leben, in der Kostenstellen gegen Codezeilen antreten?
Der stille Machtwechsel
Wer glaubt, dass Controller kalte Zahlenliebhaber sind, hat nie gesehen, wie ihre Augen glänzen, wenn sie den Return-on-Investment einer KI-Anschaffung durchkalkulieren. Produktionsmaschinen ersetzten damals die Näherinnen in Italien, Roboterarme die Schweißer in Deutschland. Heute ist es ChatGPT, das den Texter ersetzt, Midjourney, das den Grafiker alt aussehen lässt.
Das Billiglohnland war weit weg. Der Algorithmus sitzt jetzt in meinem Browser. Und er schläft nie.
Zwischen Aufwertung und Auslöschung
Natürlich: KI kann Arbeit aufwerten. Weniger Tippfehler, mehr Tempo, weniger nervige Routinen. Aber wie oft kippt das Versprechen der „Unterstützung“ ins Gegenteil? Aus Aufwertung wird Auslöschung. Aus Kollege Maschine wird Konkurrent Maschine.
Das perfide daran: Niemand schreit laut auf. Es gibt keine Streikplakate gegen einen Algorithmus. Keine Gewerkschaftsversammlung gegen ein Update. Der Widerstand bleibt stumm, weil der Gegner kein Gesicht hat.
Und jetzt?
Vielleicht muss ich lernen, mich nicht mehr nur als Human Capital zu sehen. Sondern als Human Potential. Denn Kapital kann man immer ersetzen, Potential nicht. Der Kampf Mensch gegen Maschine ist letztlich auch der Kampf darum, was wir als Gesellschaft für unersetzlich halten.
Am Ende frage ich mich: Will ich wirklich, dass meine Kinder sich mit Algorithmen um den nächsten Praktikumsplatz bewerben müssen? Oder sollten wir nicht endlich definieren, welche Arbeit menschlich bleiben muss – und nicht nur, welche Arbeit sich durch Maschinen günstiger erledigen lässt?
